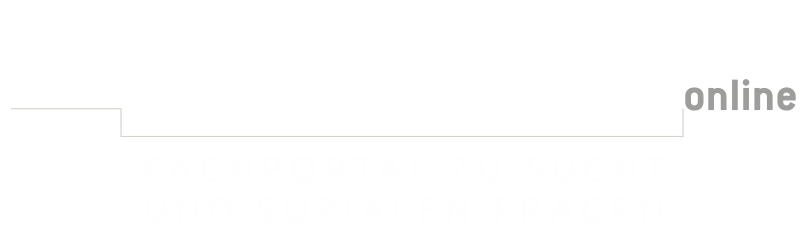Eine kritische Analyse aus Sicht von Heino Stöver und Ingo Ilja Michels

Dr. Ingo Ilja Michels

Prof. Dr. Heino Stöver ©B. Bieber Frankfurt UAS
Einleitung
Nach dem Bruch der Ampelregierung im November 2024 und vor den Neuwahlen am 23. Februar 2025 ist es an der Zeit, Bilanz zu ziehen: Wie sind die Koalitionsvereinbarungen zum Thema Drogenpolitik umgesetzt worden? Was ist erreicht worden, was nicht und warum nicht? Abschließend geht es in diesem Beitrag auch darum, was eine zukünftige Regierung zu beachten hat.
Die Koalitionsvereinbarungen der Ampelregierung zum Thema Drogenpolitik konzentrierten sich auf die folgenden Zielsetzungen:
„Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Dadurch wird die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet. Das Gesetz evaluieren wir nach vier Jahren auf gesellschaftliche Auswirkungen. Modelle zum Drugchecking und Maßnahmen der Schadensminderung ermöglichen und bauen wir aus.
Bei der Alkohol- und Nikotinprävention setzen wir auf verstärkte Aufklärung mit besonderem Fokus auf Kinder, Jugendliche und schwangere Frauen. Wir verschärfen die Regelungen für Marketing und Sponsoring bei Alkohol, Nikotin und Cannabis. Wir messen Regelungen immer wieder an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und richten daran Maßnahmen zum Gesundheitsschutz aus.“
(Koalitionsvertrag 2021-2025 „Mehr Fortschritt wagen“ vom 7. Dezember 2021, S. 68)
Die intendierten Maßnahmen in Bezug auf illegale Drogen stützen sich auf viele internationale und nationale Vorschläge zur Aufhebung der Drogenprohibition, insbesondere am Beispiel Cannabis. Viele Staaten bewerten mittlerweile die politische Fokussierung auf das polizeilich umzusetzende Drogenverbot als nicht mehr zeitgemäß – und vor allem nicht effektiv und effizient – und haben Neuregulierungen geschaffen. Dies hat zu einer Erosion des internationalen Drogenverbots (Barop 2023) mit vielen nationalen Sonderregelungen jenseits der internationalen Suchtstoffkontrollübereinkommen geführt (EMCDDA 2002/2023; FES 2015; akzept 2022).
Auch in Deutschland bestand eine langjährige Opposition gegenüber Drogenverboten, besonders gegenüber dem Verbot von Cannabis. Vor dem Hintergrund, dass der Cannabiskonsum in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, haben alle Parteien im Bundestag (bis auf die Fraktionen CDU/CSU und AfD) seit einigen Jahren drogenpolitische Veränderungen in Richtung Entkriminalisierung und sogar Legalisierung gefordert (Stöver/Michels 2024). Als schließlich die SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen im November 2021 die Regierungsverantwortung übernahmen, haben sie im Koalitionsvertrag eine Legalisierung im Umgang mit Cannabis beschlossen.
Der bloße Konsum von Betäubungsmitteln ist in Deutschland nicht strafbewehrt; strafbar sind jedoch der Erwerb und der Besitz von Drogen, die der Konsumhandlung in der Regel vorausgehen. Der Gesetzgeber hat nun auf der Basis der Koalitionsvereinbarungen zwar Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG) herausgenommen (allerdings nur bis zu einer Menge von 25 Gramm bzw. 50 Gramm zum Eigenkonsum), aber alle anderen psychoaktiven Substanzen, die in den internationalen Suchtstoffabkommen als „gesundheitsgefährdend“ und „therapeutisch ohne Nutzen“ eingestuft werden, unterliegen weiterhin dem BtMG oder sind nur in sehr wenigen und streng kontrollierten Fällen zu wissenschaftlichen Zwecken erlaubt (wie etwa neuerdings einige Psychedelika). Diese Gefährlichkeitseinschätzung hat nichts mit wissenschaftlicher Evidenz zu tun (vgl. hierzu neuere Forschungen zur Risikoabschätzung von psychoaktiven Substanzen; Nutt et al. 2010; Bonnet et al. 2021 und 2022).
Eine künftige Reform der Drogenpolitik muss sich also gerade auf die Menschen fokussieren, die andere verbotene Substanzen als Cannabis konsumieren. Bei ihnen sind die gesundheitlichen, sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen Folgen der Prohibition besonders deutlich. Das Verbot der Drogen schädigt die Menschen mehr als der Konsum der Drogen selbst. Wir konstatieren ein Problem der Drogenpolitik und nicht des Drogenkonsums an sich. Wenn auch in den letzten Jahren vermehrt der Blick auf das Schädigungspotenzial der prohibitiven Drogenpolitik gerichtet worden ist, so ist dieser zumeist nur angewendet worden auf Cannabis – u. a., weil die Zahl der Cannabiskonsumierenden mittlerweile eine Rekordhöhe erreicht hat und Cannabiskonsum aus unserer Kultur nicht mehr wegzudenken ist. Aus unserer Sicht brauchen Heroin-, Kokain- und Crackkonsumierende ebenfalls einen Rahmen, der ihnen keine weiteren Probleme außerhalb des Drogenkonsums selbst bringt.
Umsetzung der Koalitionsvereinbarungen – was ist erreicht worden?
1. Kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften
Das Konsumcannabisgesetz wurde am 21. Februar 2024 im federführenden Gesundheitsausschuss beraten und mehrheitlich verabschiedet. Es wurde dann vom Plenum mit Mehrheit der Ampelkoalition am 23. Februar 2024 beschlossen und trat am 1. April 2024 in Kraft. Seit dem 1. Juli 2024 können Anbauvereinigungen gegründet werden. Damit sind der Eigenanbau von Cannabis und die Cannabisabgabe über Anbauvereinigungen legalisiert worden, der Besitz von 25 Gramm in der Öffentlichkeit und von 50 Gramm zuhause ist straffrei gestellt worden. Noch wissen wir nicht, wie die Umsetzung gegen z. T. massive Widerstände von Ländern und den Oppositionsparteien im Bundestag, aber auch nach wie vor von Ärzte- und Richterverbänden, von Staatsanwaltschaften und selbst von Kleingartenverbänden, gelingt.
In der Anfangsphase der Koalition beabsichtigte das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) eine Cannabislegalisierung (Abgabe in lizenzierten Fachgeschäften etc.; BMG 2022). Nachdem dies aus europarechtlichen Gründen nicht möglich schien, hat man das ursprüngliche Gesetzesvorhaben in zwei „Säulen“ aufgeteilt, wovon nur die „Säule 1“, also die Abgabe über Anbauvereinigungen bzw. Eigenanbau, übriggeblieben ist. Die „Säule 2“ sah vor, dass Cannabis in Modellprojekten in lizenzierten Fachgeschäften abgegeben werden sollte – dies wurde jedoch nicht umgesetzt.
Die wissenschaftlich begleitete Abgabe von Cannabis in lizenzierten Fachgeschäften ist jetzt über eine Verordnung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft möglich geworden (Konsumcannabis-Wissenschafts-Zuständigkeitsverordnung, KCanWV, vom 10. Dezember 2024). Die Verordnung, die der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), im Dezember 2024 unterzeichnet hat, regelt, dass die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) künftig als Behörde Forschungsanträge im Bereich Konsumcannabis und Nutzhanf prüfen und genehmigen wird.
Wissenschaftliche Einrichtungen und Unternehmen können Anträge für entsprechende Projekte bei der BLE einreichen – und haben dies bereits getan (Stand: 28.01.2025). Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL 2024) teilte ausdrücklich mit, dass die nun erlassene KCanWV der BLE ermöglicht, im Zusammenhang mit Cannabis stehende Forschungsanträge zu prüfen und die genehmigten Projekte zu überwachen. Zuvor lag diese Aufgabe beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Das BfArM bleibt laut BEL zuständige Behörde für Forschung mit medizinischem Cannabis.
Forschung an und mit Konsumcannabis ist ab jetzt wieder möglich, aber erlaubnispflichtig, teilte das Ministerium mit. Forschungsanträge über einen fünfjährigen Zeitraum sind bereits eingereicht worden aus Frankfurt (geplant: vier Fachgeschäfte) und Hannover (geplant: drei Fachgeschäfte) (siehe Institut für Suchtforschung ISFF). Bremen, Berlin u. a. bereiten dies vor.
Auch wenn diese Anträge durch die BEL genehmigt werden, ist eine weitere Reform in Bezug auf Cannabis vor der Beendigung dieser fünfjährig geplanten Forschungsprojekte nicht zu erwarten. Im Gegenteil: CDU und CSU haben in ihr Wahlprogramm aufgenommen, das Konsumcannabisgesetz der Ampelkoalition wieder abzuschaffen (vgl. Süddeutsche Zeitung, 29.12.2024) – was dann aus den möglicherweise schon eingerichteten lizenzierten Fachgeschäften wird, bleibt unklar.
Fazit: Das Koalitionsvorhaben, Cannabis in lizenzierten Geschäften zu Genusszwecken an Erwachsene abzugeben, ist nur unzureichend umgesetzt worden. Geblieben sind – bis jetzt – die Legalisierung des Eigenanbaus und die Abgabe innerhalb von Anbauvereinigungen. Weitere Reformschritte sind in weite Ferne gerückt. Trotzdem muss die Cannabis-Teillegalisierung als erster, aber sehr wichtiger Schritt zur Entkriminalisierung des Konsums, Erwerbs und Besitzes von psychoaktiven Substanzen gesehen werden (Michels, Stöver 2024).
Eine dringend notwendige grundsätzliche Reform der Prohibitionslogik im Umgang mit psychoaktiven Substanzen war nicht beabsichtigt und wird von den Verbänden der Drogenhilfe weiter eingefordert werden müssen.
2. Modelle zum Drug-Checking und Maßnahmen der Schadensminderung sollen ermöglicht und ausgebaut werden
Länder wie die Niederlande, Schweiz u. a. zeigen es: Die diskrete Analyse von Drogensubstanzen auf gefährliche Zusammensetzungen hin kann helfen, die Risiken des Drogenkonsums deutlich zu verringern. Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (seit Juli 2024 „Europäische Drogenagentur“ bzw. „European Drug Agency“, EUDA) empfiehlt deshalb die Umsetzung solcher Analysemöglichkeiten – diskret, anonym und effektiv – zum Schutz der Konsument:innen. Am 19. Juli 2023 wurde mit der Implementierung des § 10b in das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) ein bundesgesetzlicher Rahmen für die Umsetzung von Drug-Checking für alle Bundesländer geschaffen.
Wie bei der Legalisierung von Drogenkonsumräumen müssen die Bundesländer für die Umsetzung von Drug-Checking Rechtsverordnungen erlassen, und dies ist bis Januar 2025 nur in einem Bundesland passiert, nämlich in Mecklenburg-Vorpommern (Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport, Pressemitteilung vom 04.06.2024). Der Stadtstaat Berlin und das Bundesland Thüringen haben bereits vorher Modellprojekte zum Drug-Checking gestartet, unabhängig von den Initiativen auf Bundesebene (vgl. Fonfara et al. 2024; Hirschfeld et al. 2024). Flächendeckend sollten von öffentlichen Stellen, z. B. von Gesundheitsämtern, Apotheken oder Landschaftsverbänden, Angebote zur Qualitäts- und Risikokontrolle von Drogensubstanzen geschaffen werden, deren Ergebnisse von Drogengebraucher:innen eingesehen werden können (Verbraucherschutz).
Die Ergebnisse der Modellprojekte in Thüringen und Berlin sind positiv. Die Evaluation des Berliner Projekts hält fest: „Die Ergebnisse zeigen, dass das Berliner Drug-Checking-Modellprojekt effektiv dazu beiträgt, Gesundheitsrisiken zu reduzieren und einen bewussteren Umgang mit psychoaktiven Substanzen zu fördern. Die hohen Akzeptanzwerte und die positiven Wirkungseffekte unterstreichen die Wirksamkeit des Angebots.“ (Evaluationsbericht 2024)
Mit der Implementierung des neuen § 10b des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) eröffnet der Gesetzgeber den Bundesländern nicht nur die Möglichkeit, sondern verpflichtet sie auch dazu, Drug-Checking-Angebote rechtlich abzusichern und zu fördern. Es ist nun an den Landesregierungen, ihrer gesetzlichen Pflicht nachzukommen. Die Wirksamkeit von Drug-Checking zur Vorbeugung von konsumassoziierten Gefahren ist belegt und die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind geschaffen. Jetzt ist es an der Zeit, diese Möglichkeit zu nutzen und die Gesundheit und Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt zu stellen. Die Implementierung von Drug-Checking ist nicht nur ein rechtlicher Imperativ, sondern auch ein Ausdruck eines modernen, humanen und evidenzbasierten Ansatzes in der Drogenpolitik (Hirschfeld et al. 2024).
Als weiteren Schritt zur Schadensminimierung lässt sich noch die Bundesförderung der Take-Home-Naloxonvergabe einordnen. Zur Bewältigung des opioidbedingten Drogennotfalls (Überdosis) und zur Senkung der Mortalität unter Opioidkonsument:innen soll Naloxon, ein bewährtes Mittel zur Behandlung des Drogennotfalls, flächendeckend als Take-Home- Rezept verfügbar gemacht werden – für Menschen mit riskantem Opiatkonsum. Das BMG-geförderte bundesweite Modellprojekt NALtrain (https://www.naloxontraining.de/) hat dazu Materialien erstellt, Trainings organisiert etc. Tatsächlich gibt es aber nach wie vor keine flächendeckende Versorgung mit Naloxon, wobei eine große Hürde die Verschreibungspflicht und die mangelnde Kooperation mit Ärztinnen und Ärzten darstellt (Fleißner et al. 2024; Fleißer, Stöver, Schäffer 2023; Wodarz 2024).
Darüber hinaus setzte sich der Drogenbeauftragte der Bundesregierung für die medikamentengestützte Behandlung Opioidabhängiger ein. Allerdings bleiben die Erfolge begrenzt. Weiterhin bleibt es bei einer großen Abnahme der Zahl der Ärztinnen und Ärzte, die überhaupt eine solche Behandlung anbieten.
Der Drogenbeauftragte hat weitere Missstände der Drogenpolitik aufgezeigt und Verbesserungen angeregt, z. B.:
- Forderung „Weg mit dem Begleiteten Trinken!“
- Diskussion um die Heraufsetzung des Zugangs zu Alkohol auf 18 Jahre
- Regulierung der Zugänglichkeit zu Lachgaskartuschen
- Diskussion um den Einbezug einer schadensminimierenden Strategie in die Tabakkontrollpolitik
- Umgang mit Crack-Konsumierenden
- und vieles mehr
Gesetzliche Veränderungen, strukturelle Verbesserungen, v. a. im Bereich der Schadensminimierung, sind daraus nicht erwachsen.
3. Alkohol- und Nikotinprävention: verstärkte Aufklärung mit besonderem Fokus auf Kinder, Jugendliche und schwangere Frauen
Tabak und Alkohol sind legal und in unserer Kultur verankert. Das Abhängigkeitspotenzial dieser Volksdrogen ist gleichwohl hoch und sie führen zu enormen gesundheitlichen und sozialen Schäden. Allein an den Folgen des Alkohols sterben pro Jahr etwa 74.000 Menschen, an den Folgen des Tabakkonsums 110.000. Beide Substanzen zählen zu den Hauptrisikofaktoren bei Krebs und anderen tödlichen Erkrankungen. Die volkswirtschaftlichen Schäden summieren sich auf Milliardensummen. Im Vergleich mit anderen Ländern tut Deutschland wenig, um die zerstörerischen Folgen für Individuen und Gesellschaft zu reduzieren. Im Gegenteil: Alkohol ist omnipräsent in der Gesellschaft. Bei der Zahl der Zigarettenautomaten – in anderen Ländern längst verschwunden – sind wir Weltmeister. 340.000 Automaten animieren im öffentlichen Raum zum Zigarettenkauf. Bei der Tabakkontrolle liegen wir laut Tabakatlas des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) auf einem der letzten Plätze in Europa. Beim Alkohol-Pro-Kopf-Verbrauch sind wir auf den vorderen Rängen.
Wir könnten Menschen Unterstützung anbieten, die das Rauchen einschränken oder Gesundheitsrisiken verringern möchten, ohne aufzuhören – mit Maßnahmen, die zu ihrem Lebensstil passen. So führt zum Beispiel nach aktuellen Studien die E-Zigarette bei einem Teil der Raucher:innen zur Verringerung oder Aufgabe des Tabakkonsums. Zugleich zieht sie kaum neue Konsumierende an, animiert also nicht zum Rauchen. In einem wissenschaftlich fundierten Diskussionsprozess gilt es nun, Chancen und Risiken der E-Zigarette abzuwägen, um dann klare Botschaften an (potenzielle) Konsumenten zu senden (Steimle, Grabski, Stöver 2024).
Die Elefanten im Raum der Drogenpolitik und Drogenhilfe bleiben also Alkohol, Tabak und Medikamente. Für all diese Substanzen mit massiven Auswirkungen auf die psychische und körperliche Gesundheit der Konsumierenden, ihrer Kinder und anderer Angehörige sowie ihres sozialen Umfeldes insgesamt hat die Ampelkoalition nicht einmal wichtige, evidenzbasierte Maßnahmen der Verhältnisprävention im Koalitionsvertrag formuliert, so weit weg ist man davon, die verursachten Gesundheitsprobleme zu adressieren – von den entstandenen volkswirtschaftlichen Schäden ganz zu schweigen!
Spürbare Maßnahmen zur Verbesserung der Alkohol- und Nikotinprävention sind in der letzten Legislaturperiode nicht erfolgt.
4. Verschärfung der Regelungen für Marketing und Sponsoring bei Alkohol, Nikotin und Cannabis
Auch zu dieser letzten Zielsetzung der Koalitionsvereinbarungen der Ampelregierung ist eigentlich nichts passiert. Das Gesundheitsministerium hat eine eigens beauftragte Studie zum Thema „Werbeverbot für Alkohol“ weder veröffentlicht, noch ist es deren Erkenntnissen gefolgt. Die Studie empfahl ein komplettes Werbeverbot (vgl. Manthey et al. 2024; vgl. tageschau.de, 08.01.2025). Dabei hatte die Regierung in ihrer Vereinbarung doch gerade explizit angekündigt, wissenschaftliche Erkenntnisse zu prüfen: „Wir messen Regelungen immer wieder an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und richten daran Maßnahmen zum Gesundheitsschutz aus.“
Wichtige, evidenzbasierte Änderungen in der Alkoholpolitik sind in den letzten Jahren nicht erfolgt: Die letzten entscheidenden Gesetzesänderungen gab es in der Zeit der rot-grünen Regierung unter Kanzler Gerhard Schröder. Damals wurde die Promillegrenze im Straßenverkehr von 0,8 auf 0,5 gesenkt sowie die Alkopop-Steuer eingeführt (tageschau.de vom 08.01.2025.
Was muss eine neue Bundesregierung im Bereich Drogenpolitik tun, um Suchtgefährdungen entgegenzuwirken? Was muss sie tun, damit Menschen mit Abhängigkeitsstörungen früher beraten und behandelt werden?
Hier seien nur einige Bereiche benannt, die für eine verbesserte Aufklärung und Kontaktaufnahme sowie für eine bessere Beratung und Behandlung von Menschen mit Substanzgebrauchsstörungen wichtige Voraussetzungen bilden.
1. Umstrukturierung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zum Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit
Im Koalitionsvertrag ist festgelegt: „Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geht in einem Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit am Bundesministerium für Gesundheit auf, in dem die Aktivitäten im Public-Health Bereich, die Vernetzung des ÖGD und die Gesundheitskommunikation des Bundes angesiedelt sind. Das RKI soll in seiner wissenschaftlichen Arbeit weisungsungebunden sein.“ (S. 65)
Das bedeutet, dass auch die Maßnahmen im Schwerpunkt der Drogen- und Suchtprävention der BZgA auf ihre Wirksamkeit überprüft und neue Konzepte zum Ausbau der Risikokompetenzförderung erprobt werden sollten. Beispielhaft sei hier auf den österreichischen risflecting®-Ansatz verwiesen (Koller 2015; https://risflecting.eu/).
Die BZgA hat eine Reihe von guten wissenschaftlichen Analysen publiziert und gute Präventionsprogramme entwickelt (wie HaLT, drugcom, Kenn Dein Limit. etc.), aber diese waren häufig nicht ausgerichtet auf risikoreiche Lebensbedingungen, sondern mittelschichtsorientiert, sodass in der Prävention des Cannabis- oder Tabakkonsums nicht die konsumentschlossenen Menschen erreicht wurden und Glaubwürdigkeitslücken existierten. Das sollte untersucht werden, um die Maßnahmen stärker auf die Vermittlung von Risikokompetenzen auszurichten und weniger auf die Verhinderung des Konsums. Diesen Prozess sollte der Drogenbeauftragte in enger Abstimmung mit dem Fachreferat Drogen und Sucht des BMG begleiten.
Überprüft werden sollte auch die Mitfinanzierung von Kampagnen im Bereich der Alkoholprävention durch die private Krankenversicherung (PKV), die damit auch versucht hat, die Entwicklung einer Bürgerversicherung zu behindern.
2. Suchtprävention und Suchthilfe stärken!
Laut einer aktuellen Studie der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) können etwa drei Viertel der Suchtberatungsstellen nicht kostendeckend arbeiten. Stellen werden abgebaut, Beratungs- und Betreuungszeiten gekürzt – das alles führt zu Wartezeiten, Abweisungen etc. Frühzeitige Hilfen, besonders bei Störungen mit hohem Chronifizierungspotenzial, sind ebenso notwendig wie verlässliche und nachhaltige Hilfen im kommunalen Suchthilfeverbund. Welche fatalen Folgen würde ein weiteres Zusammensparen der kommunalen Drogenhilfe haben!
Ein gut ausgebautes Hilfesystem rettet Leben! Die Suchthilfe braucht ein stabiles Fundament und muss angesichts jüngster Entwicklungen ausgebaut werden – unabhängig von Konjunkturen und Haushaltslagen. Es gibt den Vorschlag, Suchtberatung mit Prävention, psychosoziale Begleitung bei Substitution sowie Therapie und Selbsthilfeunterstützung für Konsument:innen und begleitende Angehörige als Pflichtaufgabe für die Kommunen zu erklären und stabil zu finanzieren. Die Krankenkassen sind angemessen zu beteiligen. Die Begleitung ist unbürokratisch und niedrigschwellig zu finanzieren. Den besonderen Schwierigkeiten bei der Inanspruchnahme des Bundesteilhabegesetzes durch Konsument:innen mit Hilfebedarf ist mit niedrigschwelligen Hilfeplanverfahren, ggfs. Fallpauschalen, zu begegnen (DHS 2023).
3. Bündelung der Steuerungskapazitäten der Drogenpolitik
Das Amt des Beauftragten der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen mit beschränkten Ressourcen und geringen Befugnissen kann so nicht länger aufrechterhalten werden! Benötigt wird eine Bündelung der Kompetenzen innerhalb einer arbeitsfähigen, interministeriell und interdisziplinär besetzten Organisation, zu deren Mitgliedern Vertreter:innen des Bundes, der Länder und Kommunen, der Verbände der Selbsthilfe sowie der Forschung und Wissenschaft gehören. Denn: Sucht- und Drogenprobleme sind ein zu großes Feld der Gesundheitspolitik (8,2 Millionen Menschen in Deutschland sind abhängig von Substanzen, Medien oder Glücksspiel etc.; 13 Millionen Menschen konsumieren Substanzen missbräuchlich), als dass man sie verstreut über mehrere Ministerien oder nur pflichtschuldig auf Minimalniveau (nur notwendige Anpassungen an EU-Vorgaben etc.) bearbeiten kann. Selbst die zuständigen Regulierungsbehörden kommen mit der Geschwindigkeit, den Dynamiken und Herausforderungen des illegalen und legalen Drogenmarktes nicht zurecht. Jüngstes Beispiel ist die Einweg-E-Zigarette, die v. a. unter jungen Menschen immer größere Verbreitung findet, weil fast jede/r Rapper:in in den Social Media ein eigenes Label mit kinder- und jugendaffiner Werbung hat. Auch eine Lachgas-Regulierung lässt auf sich warten.
Zusammenfassung
Die Koalitionsvereinbarungen der Ampelregierung sind aus unterschiedlichen Gründen nur zu einem geringen Teil umgesetzt worden. Im Wesentlichen waren sie unscharf formuliert, so dass einiges nicht operationalisierbar/messbar war. Zum Teil standen rechtliche Hürden einer Umsetzung im Weg. Die in den Koalitionsvereinbarungen formulierten Zielsetzungen spiegelten auch nur einen kleinen Teil der notwendigen Entwicklungsschritte der Drogenpolitik wider. Diese Selektivität der Zielsetzungen im Kontext dringend benötigter Reformen zeigt auch, dass diese Ziele nicht wissenschaftlich fundiert, praxisorientiert oder aus fachpolitischen Diskursen generiert worden sind, sondern sie sind jenseits und unabhängig davon formuliert worden.
Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung der Verfasser wieder und entsprechen nicht unbedingt der Meinung der Redaktion.
Hinweis: LEAP Deutschland (Law Enforcement Against Prohibition Deutschland e. V.) hat die Wahlprogramme der Parteien, die nach den vorliegenden Einschätzungen in den nächsten Bundestag einziehen können, in Bezug auf die Aussagen zur Drogenpolitik untersucht. Die Ergebnisse finden Sie HIER.
Angaben zu den Autoren und Kontakt:
Dr. Ingo Ilja Michels: Soziologe, Experte für HIV/AIDS-Prävention und Suchtbehandlung; Internationaler wissenschaftlicher Koordinator des DAAD-Programmes „SOLID – Soziale Arbeit und Stärkung von Nichtregierungsorganisationen in der Entwicklungszusammenarbeit zur Behandlung von Drogenanhängigkeit“ an der Frankfurt University of Applied Sciences; früherer Leiter des Büros der Bundesdrogenbeauftragten im Bundesministerium für Gesundheit in Berlin; jetzt: Bonn, Deutschland
E-Mail: ingoiljamichels(at)gmail.com
Prof. Dr. Heino Stöver: Frankfurt University of Applied Sciences, geschäftsführender Direktor des Instituts für Suchtforschung (ISFF), Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit; u. a. Berater der Weltgesundheitsorganisation WHO und des United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) für das Programm „Gesundheit im Strafvollzug“ (Health in Prisons Programme)
E-Mail: Heino.stoever(at)fb4.fra-uas.de
Literatur:
- akzept e. V. – Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik (Hg.) (2022) 10. Alternativer Drogen- und Suchtbericht. Lengerich: Pabst Science Publishers
- Barop, H. (2023) Der große Rausch. Warum Drogen kriminalisiert werden. Eine globale Geschichte vom 19. Jahrhundert bis heute. München: Siedler Verlag
- BMEL (2024) Fragen und Antworten zur Verordnung zur Konsumcannabis-Forschung (Konsumcannabis-Wissenschafts-Zuständigkeitsverordnung (KCanWV)) BMEL – Fragen und Antworten (FAQ) – Fragen und Antworten zur Verordnung zur Konsumcannabis-Forschung (letzter Zugriff: 07.08.2024)
- Bonnet, U. et al. (2022) Abwägung von Nutzen und Schädlichkeit von berauschenden und schmerzlindernden Substanzen aus der Perspektive von deutschen Suchtmedizinern (Weighing the benefits and harms of psychotropic and analgesic substances – A perspective of German addiction medicine experts). In: Fortschritte der Neurologie Psychiatrie, 2022, 90(01/02), 19–29; DOI: 10.1055/a-1363-0223
- Bonnet, U. et al. (2020) Ranking the Harm of Psychoactive Drugs Including Prescription Analgesics to Users and Others – A Perspective of German Addiction Medicine Experts. In: Frontiers in Psychiatry, 2020 Oct 26, 11, 592199; DOI: 10.3389/fpsyt.2020.592199
- Bundesministerium für Gesundheit (2022) Eckpunktepapier der Bundesregierung zur Einführung einer kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken. Kabinettvorlage_Eckpunktepapier_Abgabe_Cannabis.pdf (letzter Zugriff: 08.01.2025)
- Deimel, D.; Walter, L. (2023) Charakteristika und Unterstützungsbedarfe von Menschen in der offenen Drogenszene am Kölner Neumarkt. Ergebnisse einer Szenebefragung. Vortrag am 20.09.2023 auf dem Deutschen Suchtkongress in Berlin. Abstract: https://doi.org/10.18416/DSK.2023.1059 (letzter Zugriff: 07.08.2024)
- Deutsches Ärzteblatt (2020) Diamorphingestützte Substitutionsbehandlung: Die tägliche Spritze. 117(1-2): A-16 / B-18 / C-18
- DHS (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen) (2023) Eckpunktepapier zur Finanzierung der Suchtberatung vom 27.09.2023; https://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/2023-09-26-Eckpunkte_Finanzierung.pdf (letzter Zugriff 12.02.2025)
- EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) (2002) Prosecution of drug users in Europe – Varying pathways to similar objectives, Insight Series, Number 5. Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg
- EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) (2023) European Drug Report 2023: Trends and Developments.
- Evaluationsbericht Drug-Checking in Berlin (2024) Entwurf vom 30.10.2024 (noch nicht veröffentlicht)
- Fonfara, M.; Harrach, T.; Keßler, T. et al. (2024) Ein Jahr Drugchecking in Berlin. In: akzept e. V. (Hg.) 11. Alternativer Drogen- und Suchtbericht 2024, S. 122-128
- FES (Friedrich-Eberth-Stiftung) (2015) Von Repression zu Regulierung. Eckpunkte einer sozialdemokratischen Drogenpolitik. Positionspapier des Arbeitskreises Drogenpolitik. Koordinator: Burkhard Blienert, MdB.
- Fleißner S.; Stöver, H.; Schäffer, D. (2023) Take-Home Naloxon: Ein Baustein der Drogennotfallprophylaxe auch in Deutschland. Bundesgesundheitsblatt 2023 66:1035-1041 https://doi.org/10.1007/s00103-023-03705-4
- Franzkowiak, P. (1996) Risikokompetenz – eine neue Leitorientierung für die primäre Suchtprävention? In: Neue Praxis, 26, 5, S. 409-425
- Hirschfeld, T.; Betzler, F.; Majic, T.; Stöver, H. (2024) Drug-Checking in Deutschland: Von den Modellprojekten auf dem Weg zu einer rechtssicheren, flächendeckenden Implementierung. In: akzept e. V. (Hg.) 11. Alternativer Drogen- und Suchtbericht 2024; S. 117-122
- Koller, G. (2015) risflecting® – das Handlungsmodell der Rausch- und Risikopädagogik
- Leitlinien (2013) Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin (DGS e. V.) Therapie der Opiatabhängigkeit. Konsensuskonferenzen am 4. Juli 2013 auf dem 14. Interdisziplinären Kongress für Suchtmedizin in München und am 1. November 2013 auf dem 22. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin in Berlin
- Manthey, J.; Jacobsen, B.; Klinger, S.; Schulte, B.; Rehm, J. (2024) Restricting alcohol marketing to reduce alcohol consumption: A systematic review of the empirical evidence for one of the ‘best buys’. In: Addiction (4. Januar 2024), 119:799–811
- Michels, I.I.; Stöver, H; Verthein, U. (2022) Aktuelle Entwicklungen zum Einsatz von medizinischem Cannabis in Deutschland. In: Suchtmedizin 24 (1), S. 7-14
- Michels. I.I.; Stöver, H. (2024) Alles easy? Cannabislegalisierung und ihre Bedeutung für die Kommunen. In: Alternative Kommunalpolitik AKP 1/2024
- Michels. I.I.; Stöver, H. (2024) Cannabislegalisierung – nur ein erster Schritt zu einer neuen Sichtweise auf den Umgang mit psychoaktiven Substanzen! In: Soziale Psychiatrie Nr. 186, Köln Oktober 2024, S. 20-23
- Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport von Mecklenburg-Vorpommern, Pressemitteilung vom 04.06.2024, MV ermöglicht Modellprojekte zum Drug Checking
- Nießen, J. (2024) Neue Visionen für die Suchtprävention? Interview mit Dr. Johannes Nießen zum Übergang der BZgA in das Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin. In: KONTUREN online vom 15.05.2024; https://www.konturen.de/fachbeitraege/neue-visionen-fuer-die-suchtpraevention/ (letzter Zugriff: 27.01.2025)
- Nutt, D.J.; King, L.A.; Phillips, L.D.; Independent Scientific Committee on Drugs (2010) Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis“ (PDF). Lancet, 376(9752), 1558-65
- Positionspapier von Deutscher Aidshilfe, JES und akzept (2023) Stellungnahme zur Weiterentwicklung der diamorphin-gestützten Behandlung Opiatabhängiger in Deutschland vom Januar 2023
- Steimle, L; Grabski, M.; Stöver, H. (2024) Tabak Harm Reduction: Die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels in der deutschen Tabakkontrollpolitik. Bundesgesundheitsblatt 2024 67:956–961 https://doi.org/10.1007/s00103-024-03900-x
- Stöver, H; Michels, I.I. (2024) Der gesellschaftliche Umgang mit psychoaktiven Substanzen, Risiken und Substanzgebrauchsstörungen. In: Sozialpsychiatrische Informationen 4(2), 8–11
- Stöver, H.; Michels, I.I., Pritszens, N. (2024) 30 Jahre Drogenkonsumräume. In: Alternative Kommunalpolitik AKP 4/2024, S. 46-47
- Szolnai, A. (2024) 10 Jahre diamorphingestützte Behandlung in Stuttgart. Vortrag beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin am 02.11.2024 in Leipzig
- Wodarz, N. (2024) Typische Vorbehalte vs. tatsächliche Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Take-Home-Naloxon. Suchttherapie 2024 25(S 01): S. 25-26, DOI: 10.1055/s-0044-1790355