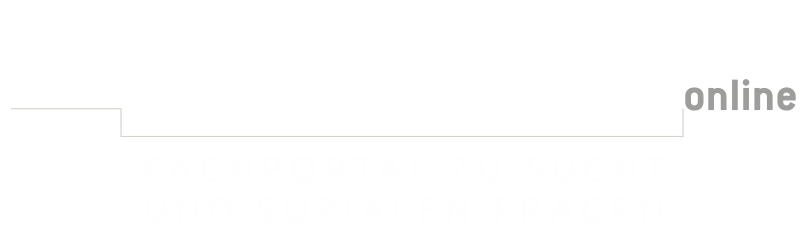Wie hoch ist die psychische Belastung am Arbeitsplatz?
Im Jahr 2013 wurden die psychischen Belastungen in die Auflistung möglicher Risiken im Arbeitsschutzgesetz aufgenommen. Im Jahr 2018 stellen sie laut DAK-Gesundheitsreport die zweithäufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit dar. Die Therapeutische Gemeinschaft Jenfeld hat mithilfe einer „Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen“ die Situation der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermittelt. Robert Meyer-Steinkamp berichtet in einem zweiteiligen Artikel über Anstoß, Durchführung und Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung. » zum Artikel