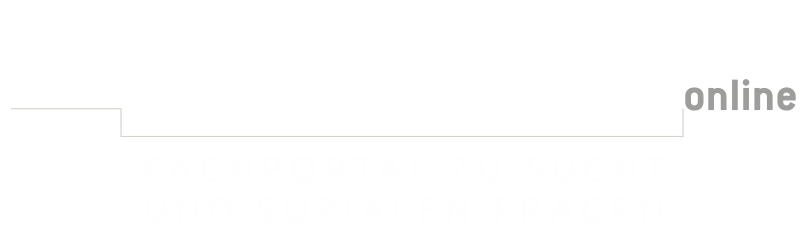Selbstvertrauen und Vertrauenswürdigkeit wiedererlangen
Der folgende Beitrag ist eine Verschriftlichung des Vortrags, den die Autorin im Rahmen der 34. Niedersächsischen Suchtkonferenz am 28. Oktober 2024 gehalten hat.
Stigmatisierung: Definition und Dynamik

Prof. Dr. Rita Hansjürgens
Stigmatisierung ist ein sozialer Prozess, bei dem Individuen oder Gruppen aufgrund bestimmter Merkmale negativ bewertet und ausgegrenzt werden. Diese Merkmale können physischer, psychischer oder sozialer Natur sein. Betroffene werden auf unerwünschte Eigenschaften reduziert, was ihre gesellschaftliche Teilhabe erheblich beeinträchtigt. Hirschauer (2021) beschreibt Stigmatisierung als eine Form der Humandifferenzierung, die kulturelle Unterscheidungen aufgreift, Personen auf unerwünschte Eigenschaften reduziert und so zu dauerhafter sozialer Ausgrenzung führt. Stigmatisierung fungiert hier als grundlegendes Prinzip sozialer Ordnung, das auf Komplexitätsreduktion und klassifizierenden Zuschreibungen basiert.
Stigmatisierungen sind auch deshalb so stabil, weil Menschen sie für ihre Selbstbeschreibungen annehmen (Selbststigmatisierung). Dadurch verstärkt sich der Stigmatisierungsprozess. Ein zentrales Konzept in diesem Zusammenhang ist das Thomas-Theorem, das besagt: „Wenn Menschen Situationen als real definieren, sind sie in ihren Konsequenzen real.“ (Thomas & Thomas, 1928) Dies bedeutet, dass die subjektive Wahrnehmung einer Situation das Verhalten der Menschen beeinflusst und somit reale Konsequenzen nach sich zieht. Ein klassisches Beispiel hierfür aus einem anderen Kontext ist ein Bank-Run: Wenn Menschen glauben, dass eine Bank insolvent ist, werden sie massenhaft ihr Geld abheben, was tatsächlich zur Insolvenz der Bank führen kann, selbst wenn sie zuvor finanziell stabil war. Wenn also Menschen eine Selbststigmatisierung aufbauen und die negativen Zuschreibungen für real und gerechtfertigt halten, verhalten sie sich entsprechend und verstärken damit die Zuschreibungen von außen. Aus psychologischer Perspektive ist daher das Konzept der selbsterfüllenden Prophezeiung, das von Merton (1948) eingeführt wurde, eng verbunden mit dem Thomas-Theorem. Eine selbsterfüllende Prophezeiung ist eine Vorhersage, die ihre eigene Erfüllung bewirkt, indem sie das Verhalten der Menschen so beeinflusst, dass die erwarteten Ereignisse eintreten.
Stigmatisierung von Sucht
Die Bewertung eines Verhaltens, das als „unmäßig“ beschrieben wird und in Zusammenhang mit dem Konsum psychoaktiver Substanzen, z. B. Alkohol, steht, ist seit der Antike eng mit gesellschaftlichen Normen und Moralvorstellungen verknüpft. In vielen Kulturen wurde ein solches Verhalten als moralisches Versagen oder Charakterfehler angesehen, was zu sozialer Ausgrenzung und Diskriminierung der Betroffenen führte, z. B. wurden sie als ungeeignet für Verantwortungspositionen eingeschätzt. Diese generalisierende Zuschreibung steht in einem engen Verhältnis mit einem weiteren Konstrukt, das als zentral für menschliches Zusammenleben eingeschätzt wird: Vertrauen. In sozialen Interaktionen ist Vertrauen essenziell. Es bildet die Grundlage für stabile und verlässliche Beziehungen. Hartmann (2020) definiert Vertrauen als das „Akzeptieren einer vulnerablen Position gegenüber einer anderen Person“. Menschen mit einem als unmäßig beurteilten Substanzkonsum, der als Sucht kategorisiert wird oder, wie es heute heißt, als Substanzkonsumstörung, werden oft als unzuverlässig und unberechenbar wahrgenommen. Sie gelten in unsicheren Situationen als „nicht vertrauenswürdig“. Ihnen gegenüber akzeptiert man nicht, in einer vulnerablen Position zu sein, denn es könnte eine Selbstgefährdung bedeuten, auf sie z. B. in der Familie oder am Arbeitsplatz angewiesen zu sein. Insofern haben Menschen, denen ein unmäßiger Konsum unterstellt wird, in sozialer Hinsicht seit der Antike ein Vertrauensproblem.
Sucht und Krankheit
Soziologisch betrachtet wird Krankheit als ein vorübergehender Zustand verstanden, der von gesellschaftlichen Normen abweicht und durch Behandlung gemildert oder geheilt werden kann. Für das Phänomen Sucht entsteht im Rahmen dieser Kategorisierung jedoch eine Herausforderung: Die Klassifizierung als „süchtig“ oder „abhängig“ dient einerseits als Voraussetzung für den Zugang zu Hilfsangeboten. Dahinter steht die wichtige Errungenschaft des Bundessozialgerichtsurteils von 1968, mit dem Sucht als Krankheit anerkannt wurde. Andererseits werden die Betroffenen durch die Klassifizierung mit negativen Zuschreibungen konfrontiert, das bestehende Stigma wird also verstärkt, weil es sich um eine klassifizierende Zuschreibung handelt. Diese Doppelfunktion der Krankheitsklassifikation führt dazu, dass Betroffene zwar Unterstützung erhalten können, gleichzeitig aber damit ihre soziale Ausgrenzung weiter vertiefen.
Schwierige bürokratische Zugänge zu Hilfsangeboten tragen ebenfalls zur Verstärkung des Stigmas bei. Wenn dann noch Hilfeangebote aus Effizienzgründen standardisiert werden, kann dies dazu führen, dass individuelle Lebenslagen und spezifische Bedürfnisse nicht ausreichend berücksichtigt werden, was die Wirksamkeit der Hilfsangebote mindert und das Gefühl der Stigmatisierung bei den Betroffenen verstärkt. Die Etikettierung als „süchtig“ kann auch dazu führen, dass Betroffene von ihrem sozialen Umfeld auf ihre Suchtproblematik reduziert werden. Dadurch werden sie in ihren Aussagen und Wahrnehmungen nicht (mehr) ernst genommen und geraten aus systemischer Sicht in die Rolle einer Indexperson , deren Verhalten als zentrale Ursache für Schwierigkeiten in einem System wie z. B. Familie oder Arbeitsplatz gesehen wird.
Rolle der Suchtberatung im sektorenübergreifenden Unterstützungssystem
Teilhabe
Die Tätigkeit der Suchtberatung ist aus sozialarbeiterischer Perspektive eng mit dem Konzept der Teilhabe verknüpft. Suchtberatung ermöglicht Teilhabe. Teilhabe bedeutet, dass Menschen aktiv am sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben auf der Basis ihrer Fähigkeiten teilnehmen können. Diese Teilnahme wird verstanden als eigene Entscheidung aufgrund einer Wahloption und erfolgt unter Einbringen der vorhandenen Fähigkeiten. Für suchterfahrene Personen bedeutet dies: Sie können selbst Angebote zur professionellen Unterstützung auswählen und auf Basis dessen, was sie mitbringen, daran teilnehmen. Vor dem Hintergrund, dass viele Angebote vor allem im medizinischen Kontext an ein Bekenntnis zu einer abstinenten Lebensweise gekoppelt sind, ist es nicht trivial, suchterfahrene Personen die Teilhabe an Hilfsangeboten zu ermöglichen. Sie gelten in medizinischen Kontexten als „schwierige Patienten“. Häufig kommen weitere Erkrankungen auf körperlicher oder psychischer Ebene (z. B. Schmerzen und/oder Depressionen) dazu, welche in Wechselwirkung mit der Suchterkrankung stehen können. Im medizinischen System Hilfe zu erhalten, ist für suchterfahrene Personen nicht selten mit weiteren Ausgrenzungserfahrungen verbunden, sodass Hilfe erst gar nicht gesucht wird. Oft wird die Ausgrenzung auch schon erwartet, und ein vorweggenommenes Abwehrverhalten (sich nicht an Terminabsprachen halten, intoxikiert kommen, latent aggressives Verhalten) trägt zum oben beschriebenen Effekt der Selffulfilling Prophecy bei, was wiederum das gegenseitige Misstrauen erhöht.
Diese Konstellation hat nicht selten zur Folge, dass unbehandelte körperliche oder psychische Erkrankungen sich in Kombination mit dem Konsum weiter verstärken bzw. sich chronifizieren. Die Gesamtsituation kann dann weiter eskalieren, wenn Erwerbsarbeit nicht mehr geleistet werden kann, das Familiensystem die Personen nicht weiter mittragen will oder am Ende der Verlust der Wohnung droht.
Soziale Nothilfe und zieloffene Beratung
Anlass für das Aufsuchen von Suchtberatung ist häufig, dass eine soziale Situation eskaliert ist, z. B. der Verlust des Arbeitsplatzes droht oder das familiäre Umfeld mit Ausgrenzung gedroht hat (Partner:in will sich trennen, Kinder dürfen nicht mehr besucht werden). Diese Situation wird von den Betroffenen nicht immer sofort mit dem eigenen Konsumverhalten in Zusammenhang gebracht, erleben sie sich doch eher als Getriebene, deren Spielräume immer enger werden. Vor dem Hintergrund der drohenden sozialen Ausschließung ist ein Hauptziel der Suchtberatung wie im „Ankerwirkmodell Suchtberatung“ herausgearbeitet (Ottmann, Hansjürgens, Tranel, 2024) daher zunächst, solche Eskalationsprozesse zu unterbrechen und die Personen in ihrem sozialen Umfeld zu stabilisieren. Dies gelingt z. B. durch Reflexion potenziell eskalierender Situationen und ggf. durch die Einleitung von Soforthilfe, z. B. durch Unterstützung bei der Integration in medizinische Behandlung oder bei der Kontaktaufnahme mit Ämtern, die Transferleistungen kürzen. Hierzu werden die Netzwerke der Beratungsstelle genutzt.
Diese soziale Nothilfe in Verbindung mit dem Reflexionsangebot in Bezug auf das Konsumverhalten ermöglicht es den Betroffenen, aus akuten Krisen herauszutreten und einen klareren Blick auf ihre Situation zu gewinnen. Durch zieloffene Beratung werden dann Wege erarbeitet, wie Betroffene ihre Lebenssituation verbessern, ggf. wieder mehr Verantwortung für ihr Leben übernehmen und damit mehr Kontrolle wiedergewinnen können. Die Zieloffenheit der Beratung stellt einen geschützten Raum dar, in dem Betroffene ihre Herausforderungen offen ansprechen können. Gemeinsam mit Berater:innen können sie Lösungen erarbeiten, die ihren persönlichen Bedürfnissen und ihrer Situation entsprechen. Die Berater:innen zeigen Vertrauen in die Fähigkeit der Klient:innen, selbst zur Verbesserung ihrer Situation beitragen zu können, und ermöglichen damit eine Gegenerfahrung zu anderen sozialen Situationen. Dies wiederum kann das Vertrauen der Klient:innen in sich selbst und professionelle Unterstützung wieder erhöhen.
Förderung selbstverantworteter Entscheidungsprozesse
Ein weiterer zentraler Aspekt der Suchtberatung ist die Förderung selbstverantworteter, auf die Zukunft gerichteter Entscheidungsprozesse. Dazu gehört z. B., dass sich eine Person entscheidet, ob sie die Krankenrolle annehmen und sich in ärztliche oder psychotherapeutische Behandlungen begeben möchte. Diese Entscheidung ist nicht trivial, weil damit Anforderungen an die Person bzgl. ihrer zukünftigen Lebensgestaltung gestellt werden, z. B. die Entscheidung für eine abstinente Lebensform. Diese Entscheidung hat in der Regel wichtige Konsequenzen für das weitere Leben der Klient:innen. Das Für und Wider wird in der Beratung ergebnisoffen abgewogen. Zentral ist, diese Entscheidung als Entscheidung der Klient:innen zu akzeptieren und im Falle einer Entscheidung gegen die Annahme der Krankenrolle auch weiter Beratung und Unterstützung anzubieten, um die Erfahrung der Ausgrenzung nicht zu wiederholen und gewonnenes Vertrauen nicht wieder zu zerstören. In jedem Fall werden die Betroffenen ermutigt, Veränderungsziele zu definieren und diese in ihrem eigenen Tempo mit Unterstützung der Suchtberatung zu verfolgen. Empowerment-Prozesse, die darauf abzielen, das Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zur Lebensbewältigung zu stärken, sind integraler Bestandteil der Arbeit der Suchtberatung. Insofern ist ein Entscheidungsprozess für oder gegen eine medizinische Behandlung zwar ein wichtiger Bestandteil von Suchtberatung, aber auf keinen Fall ihr einziger und wird auch nicht in jeder Beratung angefragt.
Brücken bauen
Darüber hinaus hilft die Suchtberatung, Brücken zwischen den suchterfahrenen Personen und ihrem sozialräumlichen Umfeld zu bauen. Dies geschieht beispielsweise durch die Förderung von Selbsthilfegruppen oder durch die Zusammenarbeit mit anderen sozialen und medizinischen Einrichtungen. Netzwerkarbeit trägt dazu bei, soziale Räume zu schaffen, in denen suchterfahrene Menschen als vollwertige Mitglieder akzeptiert werden und sich mit ihren Fähigkeiten einbringen können. Dadurch wird Teilhabe nicht nur ermöglicht, sondern aktiv gefördert.
Entstigmatisierende Wirkung der Suchtberatung
Durch die Annahme der Krankenrolle und die Integration in das medizinische Hilfesystem oder durch die aktive Umsetzung von Veränderungswünschen außerhalb des medizinischen Systems können Betroffene wieder Verantwortung für ihr Handeln übernehmen, sich zunehmend wieder als verlässliche Interaktionspartner etablieren und sich für ihr Umfeld wieder als vertrauenswürdig erweisen. Dies gilt auch für die Selbstwahrnehmung und einen Zuwachs an „Selbst-Vertrauen“. In der Folge tragen diese Prozesse mit Blick auf einen gesellschaftlichen Impact zu der Botschaft bei, dass Sucht behandelbar und bewältigbar ist. Indem Menschen durch Selbstreflexion und Unterstützung in die Lage versetzt werden, selbstgewählte Veränderungsprozesse umzusetzen, und ein soziales Umfeld dies auch wahrnehmen kann, wird ein differenzierter Blick auf suchterfahrene Menschen gefördert.
Die Unterstützung durch Suchtberatungen umfasst neben der individuellen Beratung und Begleitung von längeren Veränderungsprozessen auch die Förderung von Selbsthilfeaktivitäten und die Wiedereingliederung in soziale Netzwerke. Die Netzwerkarbeit der Beratungsstellen mit dem regionalen Unterstützungssystem (z. B. mit dem Jugendamt oder dem Jobcenter) trägt dazu bei, differenzierte Perspektiven auf Sucht auch in öffentlichen Räumen zu etablieren und Vertrauen in die Möglichkeit der Überwindung von Abhängigkeitsstörungen zu schaffen. Dies trägt dazu bei, ein generalisiertes Misstrauen abzubauen. Durch den Aufbau von Kooperationen (z. B. zwischen Selbsthilfe und Schulen) entstehen Gelegenheiten, weitere soziale Räume für suchterfahrene Menschen zu öffnen und ihnen die Möglichkeit zu geben, über ihre Erfahrungen und Veränderungsprozesse zu berichten und selbst aktiv zur Entstigmatisierung beizutragen. Indem suchterfahrende Personen (zu denen auch das soziale Umfeld gezählt werden kann) ermutigt werden, als authentische und verlässliche Interaktionspartner aufzutreten, wird ein Prozess der gegenseitigen Akzeptanz und damit die (Wieder-) Ermöglichung von Teilhabe gefördert.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Suchtberatungen einen wesentlichen Beitrag zur Entstigmatisierung leisten. Sie helfen suchterfahrenen Personen und ihrem sozialen Umfeld, gegenseitiges Vertrauen wieder aufzubauen. Durch die Unterstützung von selbstverantworteten Entscheidungen insbesondere in der Frage, ob eine suchtmedizinische Behandlung angestrebt wird, tragen sie zur Nachhaltigkeit einer solchen Behandlung bei. Darüber hinaus ermöglicht Netzwerkarbeit in den Sozialraum hinein eine differenziertere Wahrnehmung suchterfahrener Personen. Letzteres geschieht sowohl durch Bildungsarbeit als auch durch konkrete Unterstützungsangebote und die Selbsthilfe. Letztlich stellen Suchtberatungen damit eine Plattform bereit, die es suchterfahrenen Personen ermöglicht, selbst aktiv zur Entstigmatisierung beizutragen. Dies kann klassischerweise als ein Beitrag von Hilfe zur Selbsthilfe verstanden werden.
Angaben zur Autorin und Kontakt:
Prof. Dr. Rita Hansjürgens
Professorin für Handlungstheorien und Methoden Sozialer Arbeit und Allgemeiner Pädagogik
Supervisionsbeauftrage
Sozialarbeiterin M. A. Professional Studies, Clinical Social Worker & Clinical Mentor (ECCSW)
Systemische Beraterin
Alice-Salomon-Hochschule, Berlin
E-Mail: Hansjuergens(at)ash-berlin.eu
Literatur:
- Bartelheimer, P., Behrisch, B., Daßler, H., Dobslaw, G., Henke, J., & Schäfers, M. (2022). Teilhabe – Versuch einer Begriffsbestimmung. In: Wansing, G., Schäfers, M., & Köbsell, S. (Hrsg.): Teilhabeforschung – Konturen eines neuen Forschungsfeldes, S. 13–34. Wiesbaden: Springer.
- Hansjürgens, Rita; Ottmann, Sebastian (2025): Ankerwirkmodell Suchtberatung. Wirkannahmen zur Funktion Suchtberatung in: Soziale Arbeit. Berlin: DZI S. 17-24
DOI: doi.org/10.5771/0490-1606-2025-1-17 (open access) - Hartmann, M. (2020). Vertrauen: Die unsichtbare Macht. Frankfurt am Main: S. Fischer
- Hirschauer, S. (2021). Menschen unterscheiden. Grundlinien einer Theorie der Humandifferenzierung. Zeitschrift für Soziologie, 50, 155–174.
- Merton, R. K. (1948). The Self-Fulfilling Prophecy. Antioch Review, 8 (2), 193–210.
- Thomas, W. I., & Thomas, D. S. (1928). The Child in America: Behavior Problems and Programs. New York: Knopf.